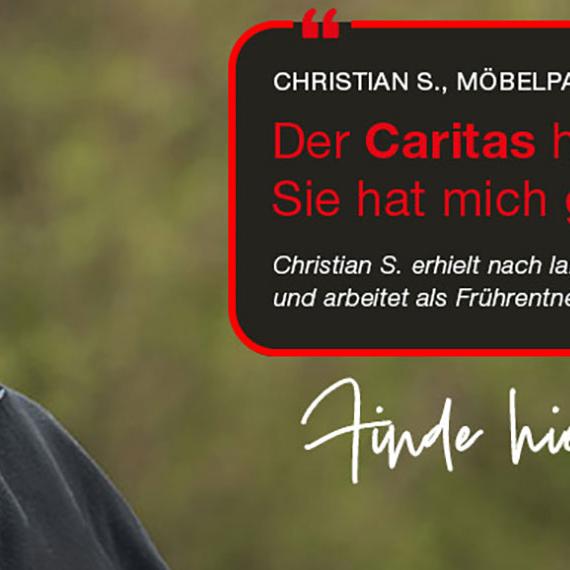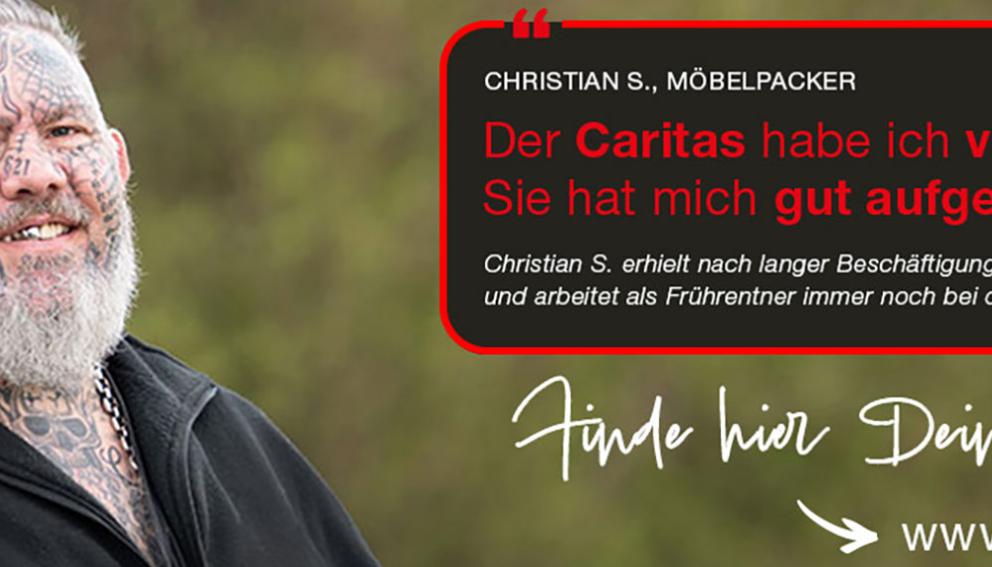Caritasverband Neustadt/Aisch: Selbsthilfekontaktstelle:„Vermittlerstelle und Brückenbauer mit Lotsenfunktion“

Einer Erhebung der Nationalen Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (NAKOS) aus dem Jahr 2022 zufolge, gibt es bundesweit zwischen 70.0000 und 100.000 Selbsthilfegruppen. Die Zahlen variieren immer wieder, weil sich viele Selbsthilfegruppen wieder auflösen oder neu gegründet werden. Außerdem erfassen weder NAKOS noch andere Organisationen die gesamte Anzahl. Der Grund: Nicht alle Selbsthilfegruppen lassen sich registrieren. Alleine in Bayern beläuft sich die Anzahl der existierenden registrierten Selbsthilfe-Gruppen Schätzungen zufolge auf 11.000. Sie organisieren sich größtenteils über sogenannte Kontakt- oder Koordinationsstellen. Die Dunkelziffer dürfte indes noch höher liegen.
Selbsthilfegruppen begleiten
Eine dieser Stellen ist das Büro für Selbsthilfe des Caritasverbandes Neustadt / Aisch. Gudrun Hobrecht leitet diese Stelle. Der sehr erfahrenen Sozialpädagogin, Hobrecht ist seit über 30 Jahren für die Caritas in Neustadt tätig, assistieren zwei Kräfte mit je zwei Arbeitsstunden. Sie aktualisieren die Website und kümmern sich um die Öffentlichkeitsarbeit. Als sogenannte Nebenstelle stehen dem Büro insgesamt 17 Arbeitsstunden zur Verfügung. „Wir verstehen uns als Vermittlerstelle, als Brückenbauer mit Lotsenfunktion“, sagt Hobrecht. „Wir begleiten Selbsthilfegruppen ganz klassisch bei der Gründung, sind Ansprechpartner für Aktive und GründerInnen, unterstützen mit Rat und Tat und moderieren auf Anfrage der Gruppen einzelne oder mehrere Treffen – etwa, wenn es infolge von Konflikten zu Spannungen in einer Gruppe gekommen ist“, so Hobrecht weiter.
30 Selbsthilfegruppen in Neustadt
Das tut das Selbsthilfe-Büro nunmehr seit über 20 Jahren, genauer gesagt seit 2003. Seither betreuen Hobrecht und ihr Team gut 30 Selbsthilfegruppen. 29 davon zählen zum Bereich Gesundheit. Diese Tendenz spiegelt sich mehr oder weniger auch bundesweit wider. „80 Prozent der Selbsthilfegruppen gründen sich zu konkreten Krankheitsbildern, 20 Prozent zu sozialen Fragen und Problemlagen“, sagt Hobrecht. Gerade soziale Fragen seien eben in Ballungsgebieten und (Groß-)Städten deutlich präsenter als etwa in ländlichen Räumen, wie z. B. hier im mittelfränkischen Neustadt. „Grundsätzlich existiert aber auch hier bei uns ein immenser Selbsthilfebedarf“, weiß Hobrecht.
Immenser Bedarf
Aber woher kommt dieser Bedarf? Fakt ist: Angesichts des demographischen Wandels, der von Phänomenen wie dem Fachkräftemangel begleitet wird, die generell angespannte Lage im Gesundheitssystem, die zu erwartenden Leistungseinschränkungen und die zukünftig schwierige Versorgungslage im medizinisch-pflegerischen sowie generell im sozialen Bereich, müssen Lösungen gefunden werden. Eine Strategie: Hilfspotentiale aus der Bevölkerung heraus aktivieren und nutzen. Vor diesem Hintergrund kommt der Selbsthilfe eine zentrale Bedeutung zu. Aber: Der Selbsthilfe kann nicht die volle Versorgungslast aufgebürdet werden. Sie kann etwa die Schulmedizin oder die fachlich-professionelle Pflege nicht ersetzen. Dennoch ist Selbsthilfe in der Lage, das soziale sowie das Gesundheitssystem insgesamt zu entlasten, wenn die Potentiale und Ressourcen der Selbsthilfe systematisch genutzt werden. „Es ist wichtig, dass wir Selbsthilfe nicht als Konkurrenz zu den professionellen Hilfssystemen – also etwa der Medizin oder der Pflege – verstehen. Insofern kann Selbsthilfe stabilisierend wirken“, ist Hobrecht überzeugt. „Das Bedürfnis von Betroffenen, sich etwa zu Erfahrungswerten auszutauschen, ist vor allem während und nach einer Therapie oder Behandlung besonders groß.“ Der Effekt sei messbar. „Wir wissen z. B., dass Selbsthilfe bei psychischen Problemlagen in der Lage ist, stationäre Aufenthalte zu verkürzen.“
3 sind eine Gruppe
Eine Selbsthilfegruppe beginnt für Hobrecht bei drei bis sechs Personen. „Eine Gruppe sollte jedoch aus nicht mehr als 15 Personen bestehen.“ Das sei die Grenze, an der noch jeder zu Wort komme. Um überhaupt eine Gruppe zu gründen, muss eine Grundvoraussetzung erfüllt sein: Kommunikation. „Wenn die Gruppe oder der Gründer dazu nicht in der Lage ist, macht auch Selbsthilfe keinen Sinn“, sagt Hobrecht. Aus ihrer Sicht ist deshalb der Zugang immens wichtig. Persönlicher Kontakt bzw. ein Gespräch seien ein ganz wesentlicher Schlüssel im Gründungsprozess, weiß Hobrecht. Hinzu kommt die Ausstattung der Gruppe mit Handwerkszeug. „Dabei handelt es sich um Wissen, dass wir an die Gruppen bzw. an die GründerInnen einer Gruppe weitergeben.“ Dazu zählen etwa Tipps zur Öffentlichkeitsarbeit, damit die Menschen überhaupt von der Gruppe bzw. dem Problem, zu dem sie sich gründet, erfahren. „Auch Fragen, wie z. B. das Setzen von Gruppenregeln oder wie komme ich an Räume, wie gestalten sich gruppendynamische Prozesse oder wie schaffe ich eine vertraute Atmosphäre, wie erfülle ich Datenschutzanforderungen, spielen in dieser Phase eine ganz wesentliche Rolle“, so Hobrecht. Dazu gebe es bei der NAKOS sehr gutes Material, „auf das auch wir hier zurückgreifen und es an die Gruppenaktiven weiterreichen.“
„Selbsthilfe-Boom hat gerade erst angefangen“
Hobrecht ist sich sicher: Obwohl die Meilensteine der Vergangenheit Selbsthilfe institutionalisierten – dazu zählen etwa die in 2008 den Krankenkassen per Sozialgesetzbuch auferlegte Selbsthilfe-Förderpflicht oder das Präventionsgesetz aus dem Jahr 2015 – und ihr maßgeblich den Weg bereitet habe, der eigentliche Selbsthilfe-Boom habe gerade erst begonnen. Indikator Nummer eins: Seit Covid treffen sich immer mehr Gruppen virtuell. „Das kann auch über die Landes- und Staatsgrenzen hinaus gehen“, sagt die 60-jährige. Die Digitalisierung verändere gerade das gesamte Konzept von Selbsthilfe. Gerade in Zeiten politischer, wirtschaftlicher und sozialer Krisen, in denen sich die Welt ja gerade befindet, sei das Bedürfnis, sich zu artikulieren, sich auszutauschen, besonders ausgeprägt. Deshalb sei Selbsthilfe auch kein Auslaufmodell. „Sie ist vielmehr demokratieunterstützend“, ist Hobrecht überzeugt.